Stadtpläne, Zäune und Ruinen faszinieren den Künstler Clemens Wolf, der seine ersten künstlerischen Erfahrungen im urbanen Raum als Sprayer machte. Heute beschäftigt sich der studierte Maler mit einer Verfallsästhetik, die malerisch, skulptural und installativ eingefangen wird. Unmanipulierte Momente werden dabei erschaffen und spielen bis zum offensichtlichen Betrug mit der Wahrnehmung des Kunstpublikums.
Clemens, wie haben sich dein Interesse für Kunst und dein damit verbundenes Studium entwickelt?
Ich habe mit fünfzehn Jahren begonnen, mich für Graffiti und Street Art zu interessieren und bin selbst zum „Sprayer“ geworden. Was zunächst illegal mit der Beschädigung fremden Eigentums begann, wurde dann zu legaler Auftragsarbeit. Später studierte ich Kunstgeschichte und Wirtschaft in Wien, wobei ich diese Studien zugunsten meines Kunststudiums in Linz aufgegeben habe.
Wien hat zwei sehr bekannte Kunstuniversitäten. Weshalb fiel deine Wahl auf Linz?
Mein künstlerischer Zugang rührt aus meiner Haltung und meinem Interesse für Graffiti und den urbanen Raum als verwendbare Kunstfläche. Ich hatte nicht das Gefühl, damit in Wien einen richtigen Weg für mich finden zu können. Meine Wahl für Linz war eine reine Bauchentscheidung. Ich fühlte mich an der Kunstuniversität Linz einfach sehr wohl und ich fand dort, was ich suchte: ein Labor. Dieses Labor ermöglichte es mir, mein künstlerisches Interesse und Potenzial zu erforschen. Ich konnte mir Techniken der Malerei, der Fotografie, des Siebdrucks und anderer Druckverfahren aneignen und meine künstlerische Arbeitsweise entwickeln.
Weshalb wurde die Malerei zu deiner bevorzugten künstlerischen Praxis?
Im Studium der Malerei wird enormes Wissen aufgebaut. Die Malerei ermöglichte mir, viel zu experimentieren und die Leinwand als meinen neuen „Playground“ zu entdecken. Alle meine Erfahrungen, die ich mit dem Medium des Graffito machen konnte, sowie der Umgang mit dem urbanen Raum, den ich als Produktionsort meiner Kunst lange nutzte, konnte ich in die Malerei einfließen lassen. Aus dem Grenzbereich zwischen Subkultur und künstlerischem Anspruch ergab sich dann mein Interesse für Ruinen, und in der Folge entwickelte sich so meine Suche nach Bestand und der Schönheit des Verfalls. Bis heute arbeite ich mich an diesen Themen ab.


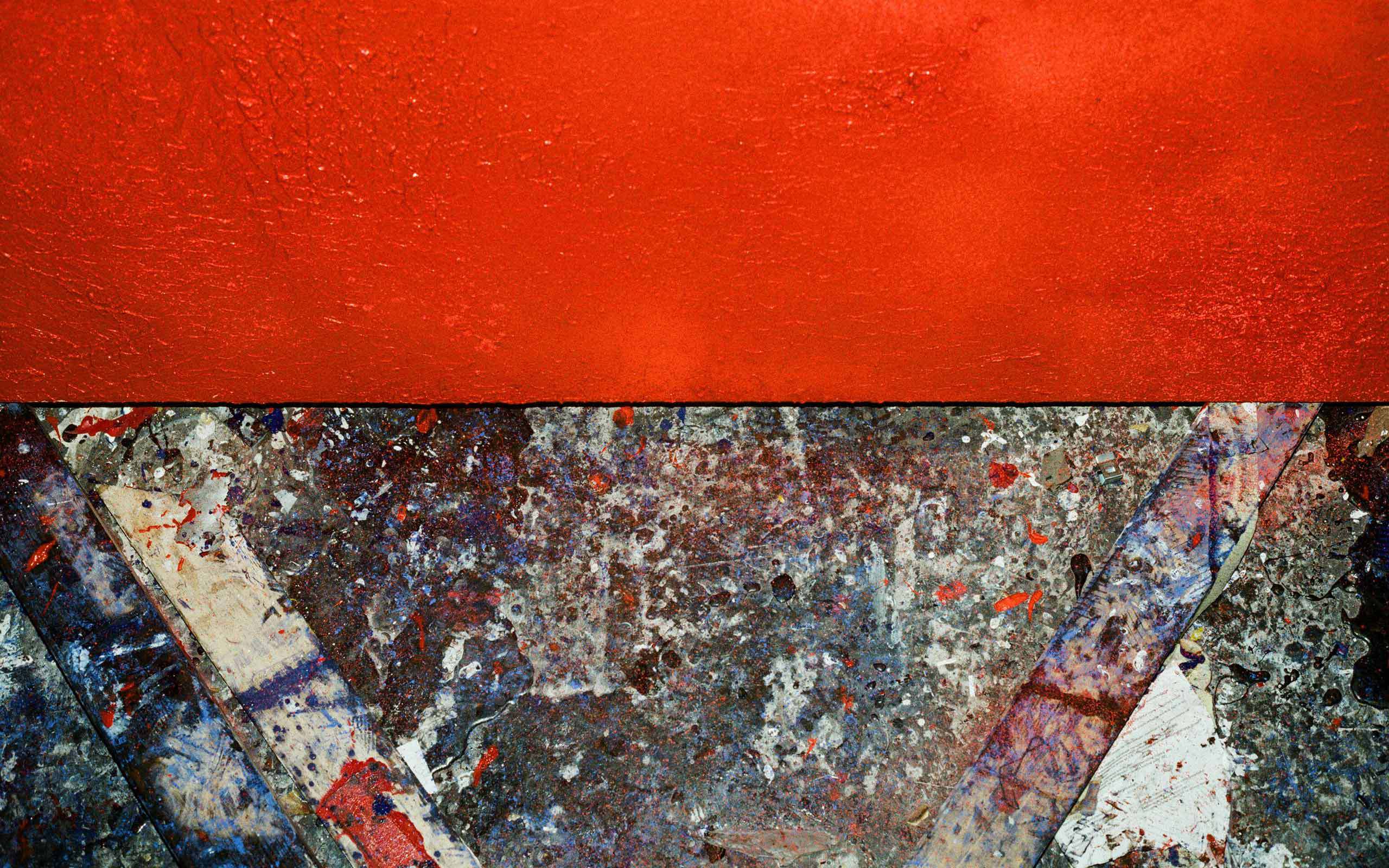
Du beschreibst dich als Maler, schaffst aber auch Installationen, die sich nicht gänzlich der Malerei zuordnen lassen. Wie erklärt sich das?
Jannis Kounellis sagte einmal, er sei Maler und seine wichtigsten Werkzeuge seien Licht und Raum. Dieser Satz hat mich sehr geprägt. Kounellis Installationen sind Malereien, die mit seinen bevorzugten Werkzeugen erschaffen wurden und Fragen nach der Definition von Malerei sowie Skulptur aufwerfen. Auch ich spiele mit diesen Fragen, indem ich die romantischen Komponenten der klassischen Malerei rund um Raum, Licht und Tiefe neu anwende. Ich bin zwar ausgebildeter Maler, jedoch bedeutet das nicht, dass ich dahingehend mein Leben in der Zweidimensionalität der Leinwand verbringe. Die Perspektiven auf meine Arbeiten können in der Erkennung von Malerei, Skulptur oder Installation resultieren. Doch am Ende des Tages ist nur wichtig, dass sich die Betrachter und Betrachterinnen auf meine Arbeit einlassen und ich den Ursprung meiner Idee formulieren kann.
Mit welchen Werkzeugen arbeitest du, um deine Werke zu schaffen?
Leinwand und Ölfarbe sind sehr präsent in meinem Werk, jedoch fetischisiere ich diverse Materialien und arbeite viel mit Scherenschnitten. Der Scherenschnitt stellt eine Verbindung zu Papier her und besitzt etwas Fragiles. Ich bin immer darauf bedacht, mit vorgegebenen Materialien zu brechen. Aus diesem Grund behandle ich Papier wie Stahl und Stahl wie Papier, wodurch sich ein „Wahrnehmungsbetrug“ ergibt. Mit diesem „Betrug“ breche ich dann wieder klassische „Kunstregeln“ und erlaube, meine Kunst physisch zu erforschen, um diesen „Betrug“ aufzudecken und Hinterfragungen zu ermöglichen.

Kannst du das anhand eines deiner Kunstwerke verdeutlichen?
Der „Wahrnehmungsbetrug“ zeigt sich ganz deutlich an meiner Serie Parachute Sculptures aus den Jahren 2015 bis 2018. Dabei habe ich Fallschirme mit eingefärbtem Epoxidharz bearbeitet, wodurch die malerischen Skulpturen zunächst nass und weich sowie auch schwer wirken. Tatsächlich sind die Fallschirmskulpturen jedoch trocken, sehr leicht und hart. Um also die wahre Konsistenz der Werke herausfiltern zu können, müssen sie physisch erfasst, also berührt werden, was bei meiner Kunst erlaubt ist, jedoch aufgrund der gängigen „Kunstregeln“ nur zaghaft passiert. Es ist aber ein wichtiger Bestandteil für die Interaktion mit meiner Kunst und um sich darauf einzulassen und darauf zu reagieren.
Welche Reaktion soll sich bei der Betrachtung auf deine Kunst ergeben?
Mir ist es wichtig, dass der Blick auf meine Kunst eine Reaktion auslöst, jedoch lege ich keine Vorgaben fest. Bei den Parachute Sculptures stehen die Betrachter und Betrachterinnen vor abstrakten Objekten, welche fremd als auch vertraut wirken. Der bearbeitete Fallschirm ist deutlich erkennbar. Doch aufgrund meiner künstlerischen Interventionen in das „Rettungsobjekt“ kommt es zu einem Spiel mit dem kognitiven Gedächtnis, wodurch unterschiedliche Fragen entstehen: Was lässt mich die Skulptur erkennen? Und was bleibt mir unbekannt? Wie kann ich das Unbekannte erforschen? Die Skulpturen erzählen eine Geschichte, die sich in der Mathematik der Schwerkraft und an der Art des „Fallens“ des Fallschirms lesen lässt.
Spielen hier der von dir bereits erwähnte Verfallsmoment und die Frage nach der Vergänglichkeit von Schönheit eine Rolle?
Ja, da ich zum Beispiel mit den Parachute Sculptures einen unwiederbringlichen Moment einfriere. Ich habe ein Jahr lang daran gearbeitet, den Moment, in dem der Fallschirm kurz davor steht, auf den Boden zu fallen, einzufangen. Man kann auch von einem nicht manipulierten Augenblick sprechen, der sich hier zeigt. 2016 sind anschließend zu den Fallschirmarbeiten die Parachute Paintings entstanden, welche die zufällige Faltenformung der Fallschirme auf Leinwand festhalten.


Wie setzt sich die Frage nach Vergänglichkeit und des „Festhaltens eines Moments“ in deiner Beschäftigung mit baulichen Ruinen fest?
Ich beschäftige mich mit dem Moment, bevor eine Ruine in sich zusammenfällt oder abgetragen wird, und welche Entwicklungen das leerstehende Gebäude bis zum endgültigen Verfall durchläuft. Ich empfinde mit Johann Wolfgang von Goethe, der eine besondere Passion für Ruinen hegte, und sehe die Anziehungskraft der Ruinen, die ich selbst in meiner Jugend erlebte, und betrachte das verfallene Haus als Rückzugsort, auch für kreatives Schaffen. Ich finde es spannend, wie sich ein leerstehendes Gebäude mit der Natur seiner unmittelbaren Umgebung verbindet oder für die Zwischennutzung verwendet wird. Nicht selten ist es ja die Kunst, die sich diese verfallenen Räume als temporäre Produktions- und Ausstellungsorte aneignet. Dahingehend funktioniert eine Ruine als Multiplikator, indem sie als Fläche für Graffiti dienen kann oder ortsspezifische Kunstwerke beherbergt und somit auch ihr Ablaufdatum verlängert.
Manche „Ruinen“, wie die Flaktürme in Wien, können nicht verfallen und werden weiter bearbeitet. Wie siehst du diese Entwicklung?
Die Flaktürme in Wien sehe ich als Denkmäler, und ich finde es sehr gut, dass sie sich nicht entfernen lassen, sondern weiterhin das Wiener Stadtbild prägen. Sie beinhalten eine wichtige Geschichte, mit der sich Österreich mehr auseinandersetzen sollte. Ihre Existenz erinnert uns immer wieder an Vergangenes und die fehlende Aufarbeitung. Mit dem Umbau des Flakturms zum Haus des Meeres im sechsten Bezirk verschwindet natürlich ein Teil der Geschichte, und ich finde es schade, dass auch das Kunstwerk von Lawrence Weiner an der Fassade des Turms gehen muss. Ich verstehe jedoch den Wunsch des Künstlers, den Schriftzug zu entfernen, da er sich nicht mit den Plänen vom Haus des Meeres vereinbaren lässt.
Kannst du von einer Ruine erzählen, die dich besonders fasziniert hat?
Ich fand das Betonwerk in Rodaun bei Wien immer wahnsinnig spannend – ein riesiger Themenpark, der erforscht werden wollte. Das erste Mal, als ich dort war, ist es noch komplett eingerichtet gewesen und verlassen, wie man es von Bildern aus Tschernobyl kennt.



Neben den Ruinen tauchen auch immer wieder Zäune in deinen Arbeiten auf. Was kannst du über diesen Zugang erzählen?
Dies hängt natürlich auch mit den Ruinen zusammen, denn vor jeder Ruine befindet sich meistens auch ein Zaun. Ich verstehe Zäune als Bezugs- und auch als Rastersysteme. Der Zaun mit seinen vielen Löchern, durch die ich hindurchsehen kann, ist die Summe aller Möglichkeiten und der Inbegriff der Aufforderung. Zäune scheinen zunächst abzugrenzen, doch lassen sie sich einfach überqueren und spielen auf subtile Weise mit denjenigen, die sich vor oder hinter einem Zaun befinden, denn je näher ich einem Zaun komme, desto mehr verschwindet dieser vor meinem Auge. Ich spiele hier mit sehr philosophischen Aspekten sowie der Frage: „Auf welcher Seite stehst du?“
Wie werden die Zäune von dir in die Kunst getragen?
Die Thematik rund um Zäune beschäftigt mich bereits seit 2009. Ich sehe darin eine Möglichkeit, meine Vergangenheit mit der Leinwand zu verbinden. Ich habe sogenannte Stahl-Cut-Outs, also Scherenschnitte mit einem Plasmacutter aus Stahl gemacht oder zerteilte und vergoldete echte Zäune, habe Löcher größer werden lassen und Unregelmäßigkeiten im vorhandenen Material hervorgehoben. In der Serie Expanded Metal Paintings verwende ich das Streckmetall als Pinsel, indem ich es sehr dick mit Ölfarbe bestreiche und dann durch Abdrücken auf der Leinwand zu Malerei werden lasse. In einem Projekt im öffentlichen Raum, am Gaudenzdorfer Gürtel, habe ich den Zaun um einen „Basketballkäfig“ vergoldet, um sprichwörtlich einen „goldenen Käfig“ zu erschaffen.
Der urbane Raum als Kunststätte lässt dich nicht los. Wie arbeitest du im öffentlichen Raum?
Ich beginne mit den Themen, die mich in meinem gesamten Werk beschäftigen. Dazu gehören, wie gesagt, Ruinen, Zäune und der „Wahrnehmungsbetrug“. In Bad Gastein, anlässlich der sommer.frische.kunst habe ich 2013 die Bauzäune der vier leerstehenden Belle-Epoque-Häuser des Wiener Investors Franz Duval vor Ort vergoldet. Diese Arbeit wurde schnell zu einer Touristen- und Touristinnenattraktion und hat den verfallenen sowie sehr geschichtsträchtigen Gebäuden neue Aufmerksamkeit geschenkt. Ich habe zusätzlich am Hauptplatz in Bad Gastein einen großen Haufen Granitsteine aufgeschüttet und diese mit Goldfarbe besprüht. Täglich konnte ich beobachten, wie Menschen heimlich einen Stein entnahmen und ihn dann wieder zurücklegten, nachdem sie bemerkt hatten, dass dieser nicht aus echtem Gold bestand. Ich habe hier also ihre Wahrnehmung verändert und eine Intervention hervorgerufen. Durch das Zurücklegen der entfernten Steine wurde nach und nach durch die Betrachter und Betrachterinnen selbst das Kunststück entlarvt und es blieb nicht dasselbe. Ich fand meine Arbeiten sehr passend, da Bad Gastein eine ehemalige Goldgräberstadt ist.

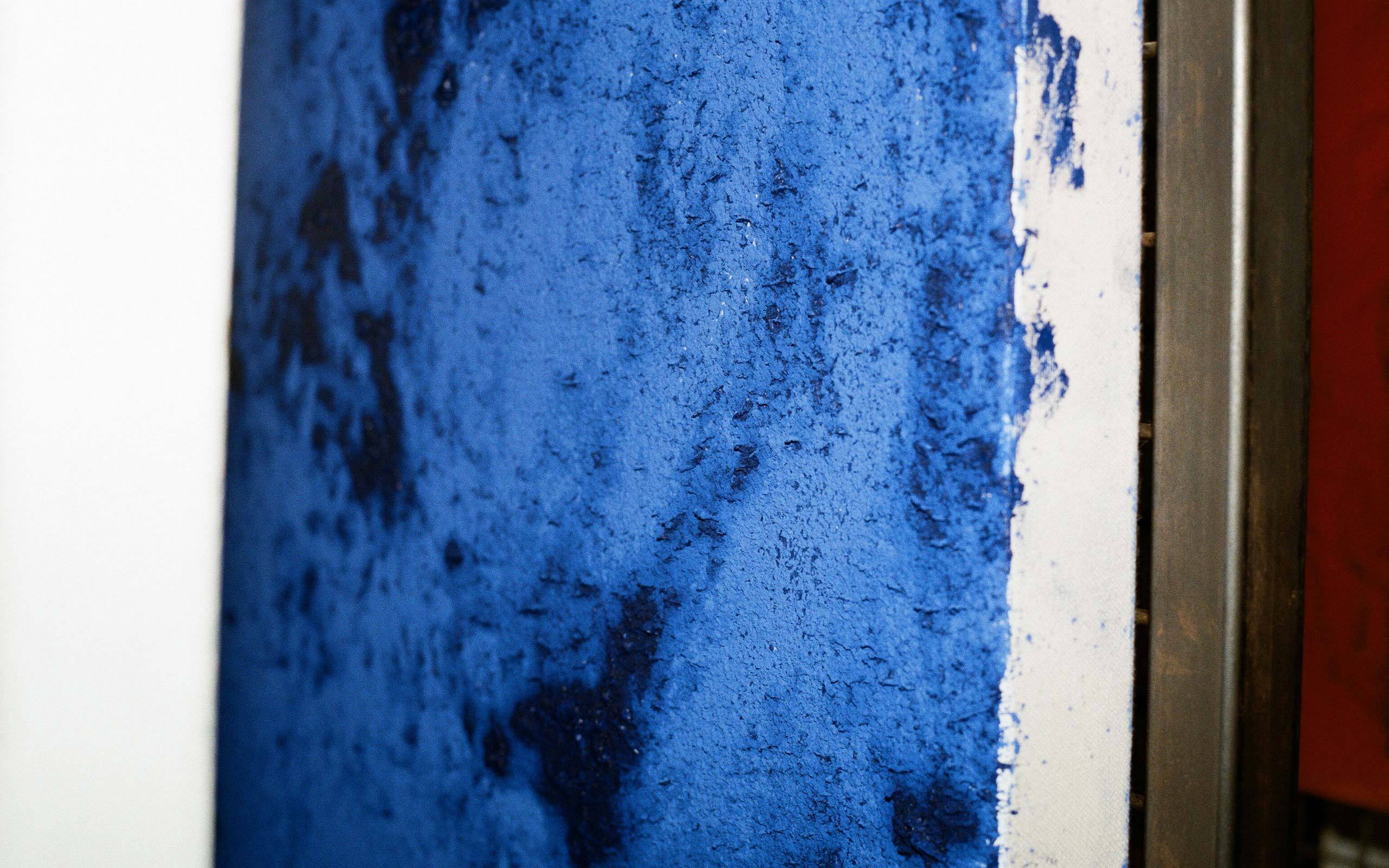

Die Kunst im öffentlichen Raum wird besonders von unmittelbaren Anrainern und Anrainerinnen infrage gestellt oder nicht verstanden. Wie gehst du damit um?
Anders als in Bad Gastein habe ich schon oft erlebt, dass sich Menschen lautstark fragen, wer denn diese Kunst bezahle und ob Steuergelder da mitfließen. Ich konnte auch hören, wie nach roter statt nach goldener Farbe verlangt wurde. Ich störe mich jedoch nicht an diesen Fragen, denn für mich sind sie ein erster Einstieg in eine Auseinandersetzung mit meiner Kunst. Diesen Moment kann ein Künstler oder eine Künstlerin nur im öffentlichen Raum erreichen. Ein Museum kommt nicht so weit, sondern bedient bereits ein kunst- und kulturaffines Publikum, das die finanzielle Kunstförderung gar nicht infrage stellen muss. Ich arbeite gerne an Orten, die sich fernab großer Museen oder Galerien befinden, da sich hier erst eine richtig spannende Herausforderung ergeben kann.
Die Bedeutung von Street Art für die Kunstgeschichte ist noch nicht gänzlich geklärt. Viele Stimmen sprechen sich gegen Galerien aus, die sich auf Street Art fokussieren, und stellen deren künstlerische Bedeutung infrage. Welche Meinung vertrittst du als doch ehemaliger Sprüher und nun bildender Künstler zu diesem Thema?
Ich denke, dass man unterscheiden muss, ob es sich dabei um Werke von Street-Art-Künstlern handelt, die für die Präsentation in einer Galerie entstanden sind, oder tatsächlich um Werke von der Straße. Im letzteren Fall finde ich, dass die Magie der Arbeiten durch die Verortung verloren geht. Man kann dann nicht mehr von Street Art sprechen, da die „Street“ fehlt. Am Ende des Tages ist das ein Frage, die sich die Street-Art-Künstler und -künstlerinnen selbst stellen müssen. Sie müssen bestimmen, welche Strategie sie verfolgen wollen. Street Art und Graffiti sind für den öffentlichen Raum als eine Art Kommunikationsinstrument erschaffen worden und funktionieren halt auch nur dort am besten. Ob und wer darüber entscheiden kann, ob dies Kunst ist oder nicht, ist meiner Meinung nach eine eher philosophische Frage.

Interview: Alexandra-Maria Toth
Fotos: Christoph Liebentritt
Links:
Clemens Wolfs Website
Galerie Steinek, Wien
Galerie Clemens Gunzer, Zürich/Kitzbühel
BACKSLASH gallery, Paris






