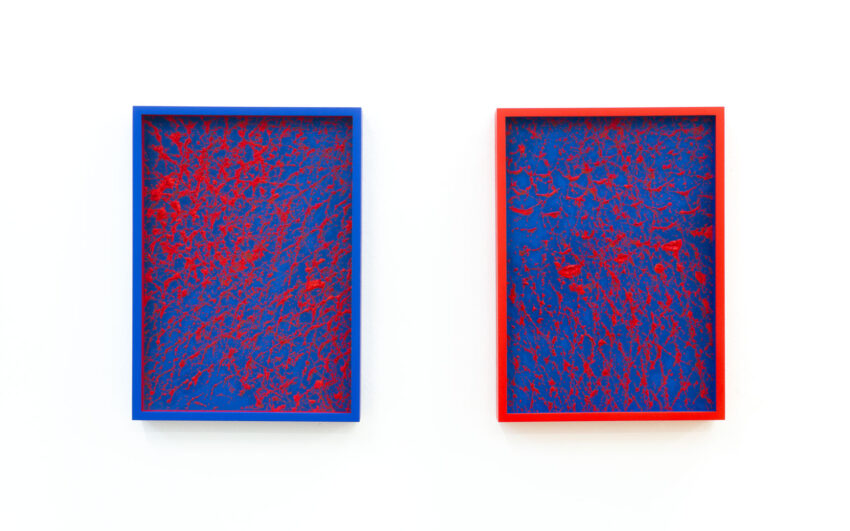Daniel Domig malt gegen den flüchtigen, von digitalen Medien geprägten Blick des schnelllebigen Bilderkonsums. Dabei versteht er es, mit schnellem und leichtem Pinsel visuelle Kommentare zu finden. Wir trafen ihn in seinem Atelier im siebten Wiener Gemeindebezirk. Er hat für uns den kanadischen Holzofen angeheizt. Im Raum riecht es angenehm nach Ölfarbe.
Daniel, Kälte scheint dir nichts anzuhaben, denn du bist in Kanada geboren, richtig?
Ja genau, ich bin in Kanada geboren. Mein österreichischer Vater hat damals in Kanada studiert. Zwei Jahre später sind meine Eltern wieder nach Österreich zurückgegangen, und ich bin in Österreich groß geworden. Durch meine amerikanische Mutter bin ich zweisprachig aufgewachsen und immer wieder in die USA gereist. Mein Bruder lebt auch heute noch in New York und ist Schauspieler. Meine Schwester und ich sind in Europa geblieben, und ich habe mein Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien begonnen.
Bist du noch oft in Amerika?
Ich habe die letzten Jahre immer wieder in New York ausgestellt. Jane Kim, meine Galeristin, hat dort mit den „Thrust Projects“ angefangen und danach folgten Ausstellungen in der „33 Orchard Street“. Mittlerweile sind wir auch gute Freunde geworden, was im Grunde alle meine beruflichen Beziehungen auszeichnet. Egal ob es Sammler, Galeristen oder Kollegen sind.
Deine Eltern sind Therapeuten, haben also keinen kreativen Beruf. Du kommst also nicht aus einer Künstlerfamilie. Wie bist du zur Kunst gekommen?
Von uns Kindern stammt die Theorie, dass die kulturelle Spannung zwischen einem Vorarlberger als Vater und einer Amerikanerin als Mutter dazu beigetragen hat. Wir haben schon als Kinder gemerkt, dass es große finanzielle Unterschiede zwischen den Familien meines Vaters und meiner Mutter gab. Auf amerikanischer Seite: zwei, drei Autos, die Kühlschränke viermal so groß. Uns war klar: ein anderes Land mit einer anderen Kultur. Unsere Familie hat das zusammengebracht. Das hat den Weg geebnet, um zu schauen, was möglich ist und wie man leben kann. Weiters gingen wir auf ein musisches Gymnasium, von dessen Abgängern viele heute Musiker und bildende Künstler sind. In einem Alter, in dem es sehr prägend ist, was deine Freunde denken, waren wir eine Gruppe von jungen Menschen, die sich alle gegenseitig unterstützt haben.
Hast du damals schon die Entscheidung getroffen, Kunst zu studieren?
Ich hatte das Glück, dass es für mich eine natürliche und fast instinktive Entscheidung war, Kunst zu machen. Wenn Leute fragen, ob sie Kunst machen sollten, ist meine Antwort meistens: Wenn es eine Option zwischen Kunst und etwas anderem gibt, dann mach’ das andere. Die Wahrheit ist, dass es für die meisten Studenten nach dem Studium nicht so gut läuft. Dadurch, dass man diese Leute meist nicht interviewt, sondern nur die bekannten Künstler, bekommt man in der Öffentlichkeit natürlich einen anderen Eindruck. Man müsste ein Magazin herausbringen, in dem nur Interviews mit Leuten gemacht werden, die Kunst studiert haben und jetzt in einer Bank arbeiten. Aber bei mir war es zum Glück so, dass ich sehr jung damit angefangen habe und dass meine Eltern nichts mit Kunst zu tun hatten – das war im Nachhinein gesehen ein Glück, weil meine Vorstellung von einem Künstler und dessen Leben im Grunde sehr klassisch, fast romantisch war, je nachdem wie man es sieht. Ich habe gedacht, dass ich arm leben und mich aus reinem Idealismus ernähren würde, und wenn ich dann sterben würde, würde irgendwer im Keller meiner Eltern meine Arbeit finden und draufkommen, dass diese nicht so schlecht war.
Glaubst du, dass ein solcher Idealismus den Kunststudenten heute fehlt?
Ich glaube schon, dass es Leute gibt, die ein Kunststudium aufgrund eines Missverständnisses beginnen. Sie denken, wenn man einfach gute Kunst macht oder irgendwo in eine Galerie reinkommt, dann läuft es. Sollte der Erfolg ausbleiben – und für die meisten bleibt er eben aus –, was macht man dann? Wie schafft man es, die Arbeit so zu verankern, dass man über 10 oder 20 Jahre hinweg nicht nur hin und wieder im Atelier ist, sondern täglich. Vielleicht funktioniert es irgendwann mit dem Künstlerdasein – wenn du Glück hast noch zu Lebzeiten, wenn du Pech hast, erst danach.
Du arbeitest grade an einer sehr großformatigen Leinwand. Ungewöhnlich im Vergleich zu deinen anderen Arbeiten.
Das stimmt. Die Arbeit ist aber noch ganz am Anfang. Sie wird in die evangelische Kapelle des AKH (Allgemeines Krankenhaus Wien) kommen – als Fastentuch. Das Tuch muss am Aschermittwoch bereits fertig sein. Deshalb habe ich die letzten zwei Wochen quasi durchgearbeitet. Vom Format her ist es tatsächlich die größte Arbeit, die ich jemals gemacht habe. Ich werde sie zum Transport auch rollen müssen, damit ich die Leinwand überhaupt aus dem Atelier bekomme.



Wie fängst du mit einer Arbeit an? Skizzierst du zuerst?
Nein, es gibt nie Skizzen. Ich wende im Grunde die Methodik des abstrakten Expressionismus an. Einfach starten und schauen was passiert. Meistens sind meine Leinwände auch ohne Grundierung. Das Sujet entwickelt sich dann nach und nach.
Zum Beispiel die Schnörkel (auf dem Fastentuch) sind einfach gekommen, da ich, um noch einmal den Prozess zu beschleunigen, die Farbe gar nicht mehr aus der Tube drücke und mit dem Pinsel verteile, sondern sie direkt auf die Leinwand bringe. Das kommt dem Modellieren mit Ton sehr nahe. Alles ist sehr flexibel und man kann in das Material jederzeit eingreifen. Das ist hier im Prinzip der gleiche Prozess. Zu Beginn ist viel Rohmaterial auf der Leinwand, das dann weitergeformt wird. Dieser Umformungsprozess dauert relativ lange. Die andere Möglichkeit ist das eher langweilige Ausmalen von Bildern, die man schon kennt. Für mich ist es spannender zu sehen, was sich hinter der Malerei befindet.
Man kann aber nicht von Zufall sprechen. Es ist ja nicht so, dass du einfach irgendwie eine Linie zeichnest und dir denkst, dass da jetzt ein Auge hinkommen könnte.
Gilles Deleuze hat in seinem Buch über Francis Bacon immer wieder eine Form von „controlled chaos“ beschrieben. Das trifft es wahrscheinlich am ehesten. Die Wahrheit ist – und das ist ja auch die Illusion –, dass ein Künstler nie 100% frei ist. Man ist dem eigenen Material was schuldig. Es ist ähnlich wie mit einem Forscher, der über 20 Jahre im Labor Daten sammelt und irgendwann streicht man ihm die Förderung. Jetzt hat er die Option, ob es ihm wirklich nur um das Geld ging und er aussteigt oder er den Rest seines Lebens die Daten auswertet, die er angesammelt hat. So ähnlich sehe ich das auch. Über die letzten 10 Jahre habe ich Daten angesammelt: ein Vokabular an Figuren und Formen. Und ich werde mein restliches Leben wahrscheinlich damit verbringen, darauf zu kommen, worum es eigentlich geht. Man muss sich immer wieder selbst in das Labor begeben und einfach entspannt sein und vertrauen, dass es schon einen Sinn und Zweck hat.
Deine Arbeiten beschäftigen sich immer mit Figurativem.
Ja, Figuren tauchen immer auf. Selten sind es jedoch anatomisch-korrekte Figuren. Man merkt, glaube ich, schnell, dass es mir nicht um eine Abbildung geht. Auch wenn es legitim ist, fotografische Hilfen zu verwenden, Bacon beispielsweise machte das auch, ist das für mich die Bruchstelle mit der Fotomalerei. Im Endeffekt haben wir kaum noch ein Verständnis von uns selbst, wenn wir uns nicht abgebildet sehen. Das erklärt auch den Hype der „Selfies“. Wir müssen sie immer und immer wieder machen, weil wir ein so schlechtes Körperbewusstsein besitzen, dass wir unsere eigene Identität verlieren, sobald wir nicht unser Abbild sehen. Diese Möglichkeiten vom perfekten Spiegelbild als auch von dem tatsächlichen Foto sind so modern, dass man sich fragen muss, wie die Menschheit überhaupt so viele Jahre ohne den „Selfie-Stick“ überlebt hat. Meine Figuren sind sicher näher an der Figur, die kein Verständnis davon hat, wie sie aussieht. Das macht es oft ein bisschen schwieriger in die Bilder einzudringen, weil man diesen „entry-point“ der Fotografie nicht hat. Das ist auch der Grund, warum die Fotos als Vorlage bei mir irgendwann verschwinden mussten.
Du hast an großen Ausstellungen im In- und Ausland teilgenommen. Was ist es für ein Gefühl, bei einer Ausstellung im Mittelpunkt zu stehen?
Man könnte sagen, dass es ein „necessary evil“ ist, um als Künstler weiter zu existieren. Jeder freut sich natürlich, wenn man Ausstellungen hat und Arbeiten verkauft. Für mich als Familienvater hat es schon einmal ganz pragmatische Gründe, um meine Familie ernähren zu können. Es ist gut, dass es Leute gibt, die tatsächlich sehr an der Kunst interessiert sind und ihr Geld dafür ausgeben. Das war schon immer so, und es ist auch etwas sehr nobles. Ich kenne viele Künstler, die sich im Kontext einer Ausstellung sehr schwer tun, weil eben die Spannung so hoch ist. Das ist auch eine Sache, die man ein bisschen lernen muss: Was es heißt, da mitzuspielen und sich selbst nicht zu verleugnen oder zu vergessen.


In der Ausbildung wird den Studenten heute stärker als früher beigebracht, sich selbst zu vermarkten. Man hat auf alle Fälle den Eindruck.
Ja, da gibt es sicher eine Veränderung im Vergleich zu meiner Zeit an der Akademie. Es gibt jetzt viel mehr Leute, die sich super vermarkten können. Sie haben dann den Nachteil, wenn tatsächlich Leute anbeißen und sie eine Ausstellung machen müssen. Dann ist der Kontrast zwischen dem, was sie über ihre Arbeit sagen und was sie machen, häufig relativ groß. Wenn ich es mir aussuchen könnte, entweder gute Arbeit zu machen und schlecht drüber zu reden oder umgekehrt, würde ich einfach die Arbeit gut machen wollen. Wie gesagt, wenn ich nicht mehr da bin, um daneben zu stehen, muss die Arbeit für sich selbst sprechen.
Du hast vorhin Francis Bacon angesprochen. Ist er einer deiner Heroes?
Es gibt viele Dinge, die ich an ihm schätze, er war sicher einer der wenigen Maler, die es im Zeitalter der Fotografie geschafft haben, die Figur malerisch am Leben zu halten. Man sieht es auch bei den Atelierfotos. Im Grunde hat er die Fotos zerstört. Die Vorlagen, die er verwendet hat, waren Fotografien, die sich dem Atelier unterordnen mussten. Sie sind zerrissen am Boden gelegen und waren bemalt. Nur mit diesen Vorlagen konnte er arbeiten. Die langweiligste Gegenbewegung zur Fotografie ist fast immer eine abstrakte und informelle Position, die versucht, die Figur selbst gar nicht mehr zu behandeln, weil sie im Grunde schon von dem Foto belagert ist. Bacon war einer, der hier die Meinung vertrat, dass es eine Möglichkeit der Figur innerhalb der Malerei gibt, die nicht eine Unterordnung darstellt und nicht im Schatten der Fotografie steht.
Seit ein paar Jahren hat sich der Begriff der „Post-Internet-Art“ etabliert. Dahinter stecken Künstler, die weniger Kunst über das Internet machen, sondern vielmehr mit dem Material arbeiten, das sie dort finden. So wie wir dich hier kennengelernt haben, ist das doch eine ganz andere Welt als deine.
Mir ist, was die digitale Kunst betrifft, schon aufgefallen, dass diese natürlich das Internet als Verbreitungsmedium nutzt, was den Prozess des Sehens beschleunigt. Anders bei der Malerei. Wenn man sie nicht als Abbildung oder auf Instagram sehen will, muss man dort hingehen, wo sie ist. Beim Künstler im Atelier oder in der Galerie. Das verlangsamt natürlich den Prozess des Sehens. Digitale Dinge kann man einfach durchscrollen und dabei relativ viel auf einmal erfassen. Oftmals kommt es mir allerdings so vor, dass bei der digitalen Kunst Dinge, die oft im ersten Augenblick extrem progressiv wirken, im Grunde auch einer ganz klassischen Komposition, die sich oft aus der klassischen Kunstgeschichte speist, folgen. Diese Anti-Ästhetik, die sich manche Künstler zu eigen gemacht haben, etwas zu fotografieren und es so „ugly as possible“ zu machen – das sind oft etablierte, künstlerische Strategien, die man sich einfach aneignet hat, um sie dann als gepixeltes jpeg-Bild zu verpacken.




Woody Allen sagte einmal: „Wenn man ein halbes Jahr keinen neuen Film macht, meinen die Leute gleich, man schläft jeden Tag bis zwölf und sitzt nur auf der Couch.“ Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Dank meiner Kinder, die früh aufstehen, hat sich natürlich eine Routine ergeben. Ich bin von Natur aus jemand, der sehr lange schlafen würde, aber ich bringe die Kinder in den Kindergarten, nächstes Jahr in die Schule und gehe dann ins Atelier. Meine Familie verhilft mir zu einer guten Distanz zur Arbeit, damit ich nicht abends aus dem Atelier rausgehe und mich nur mit mir selbst beschäftige. Zuhause ist es irrelevant, dass ich Künstler bin, da bin ich in erster Linie Ehemann und Vater. So kommt man dann am nächsten Tag tatsächlich mit einem viel klareren Blick ins Atelier.
Wie ist es für deine Kinder, dass der Papa nicht in der Bank arbeitet, sondern Künstler ist?
Es ist selbstverständlich für sie, dass Malen mein Beruf ist. Ab und an sind sie bei mir im Atelier. Aber ich trenne die zwei Bereiche Familie und Arbeit auch ganz bewusst – ein Herzchirurg nimmt seine Kinder auch nicht mit zur Arbeit –, dadurch haben sie einfach das Gefühl, ihr Papa macht einen normalen Job und macht ihn gerne. Das ist das Schönste, was man seinen Kindern mitgeben kann. Das Gefühl, dass Arbeit etwas Gutes ist. Man sollte auch etwas machen, was einen selbst begeistert. Sie hören mich nie sagen „Ach, jetzt muss ich schon wieder ins Atelier“, und deshalb werden sie ein positives Bild von kreativer und menschlicher Tätigkeit haben. Das ist das Wertvollste. Was sie selbst später machen, ist mir egal. Sie können dann auch sehr gerne in einer Bank arbeiten. Es würde mich allerdings schon stolz machen, wenn eines meiner Kinder Maler werden würde. Ich habe eine Zeit lang auch den blöden Witz gemacht: „Meine Kinder sollen etwas Vernünftiges machen“, aber mittlerweile denke ich mir, dass die Kunst eine sehr noble Tätigkeit ist.


Interview: Michael Wuerges
Fotos: Maximilian Pramatarov