Nick Oberthalers Bilder entwickeln sich aus einem konzeptionellen Überbau: Farbe und Flächen übernehmen dabei eine kodifizierende Rolle und stellen Bezüge zu Thematiken her, die beispielsweise aus der Bildtheorie, der Kunstgeschichte, den Naturwissenschaften oder der Philosophie entlehnt sind. Er hinterfragt inhärente Konventionen, anstelle nur Formenvokabular zu beschreiben. Wir besuchten Nick in seinem Atelier, um die konzeptionelle Tiefe seiner Arbeiten besser zu verstehen, und um darüber zu sprechen, warum ihm Diskurs wichtiger ist als der eigentliche Malprozess.
Nick, du hast bereits mit achtzehn Jahren angefangen Kunst zu studieren. Warum eigentlich Kunst? Und wie kann man sich mit achtzehn seiner Sache schon so sicher sein?
Eigentlich wollte ich in die Gebrauchsgrafik. Wenn man aus einer ländlichen Gegend stammt – ich komme aus dem Salzkammergut –, bringt man noch keine konkrete Vorstellung mit, was den Kontext der zeitgenössischen Kunst ausmacht. Du willst erst einmal einfach in die große Stadt und weg aus der Provinz. Wenn man eine kreative Richtung einschlagen will, liegt die Gebrauchsgrafik nahe. Ich habe damals mit einer Bekannten gesprochen, die an der „Angewandten“ [Universität für Angewandte Kunst in Wien] studierte, mir erschien das Studium dort aber als zu eng und verschult. So bin ich zur freien Kunst gekommen und habe dann an der Akademie der bildenden Künste Wien Malerei studiert.
Du hast deine Anfänge als Künstler mittlerweile weit hinter dir gelassen. Was bleibt noch aus dem Kunststudium?
Natürlich nimmt man einiges mit, bekommt einen Überblick über die Kunstgeschichte und lernt, Dinge einzuordnen. Ich habe aber über die künstlerische Praxis hinaus nie diesen Drang gehabt, theoretisch oder wissenschaftlich zu arbeiten, die Kunstausbildung damals hat auch nicht den gleichen Wert darauf gelegt, wie es aktuell der Fall ist. Neulich allerdings habe ich zum ersten Mal für einen befreundeten Künstler einen kurzen Ausstellungstext geschrieben – das war eine interessante Erfahrung. Wie schreibt man so etwas eigentlich? Wie nähert man sich einer anderen Arbeit sprachlich?
Du sagst, du arbeitest nicht per se wissenschaftlich, bist kein Kunsttheoretiker, aber du webst schon viele kunsttheoretische Themen in deine Arbeit ein, oder?
Ich denke schon, dass meine künstlerische Arbeit mit einer gewissen theoretischen Auseinandersetzung zu tun hat, und halte es für notwendig, diese in die eigene Praxis zu überführen.
Du beschäftigst dich ja nicht nur mit Kunsttheorie. Oft stammen deine Bezüge aus der Philosophie, manchmal aus den Naturwissenschaften oder der Politik, also aus eigentlich sehr kunstfernen Gebieten.
Die Inhalte, mit denen ich mich beschäftige, stammen aus allen möglichen Bereichen: Bildtheorie, Belletristik, wissenschaftliche Essays oder tagespolitische Berichte. Ich mäandere eigentlich ständig zwischen verschiedenen Themenfeldern. Es kommt eher selten vor, dass ich Schriften konstant in einem Zug lese, vielmehr verfolge ich sozusagen eine Art rhizomatisches Lesen.
Die französischen Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari haben den Begriff des Rhizoms als Metapher für ein postmodernes beziehungsweise poststrukturalistisches Modell der Wissensorganisation und Weltbeschreibung geprägt. Ihrer Theorie zufolge vermittelt sich Wissen nicht auf einem linearen Strang oder auf einer Ebene, sondern dreidimensional und anti-hierarchisch. Sehr ähnlich verhält sich die Herangehensweise bei meinen Recherchen und auch in meinem Arbeitsprozess.

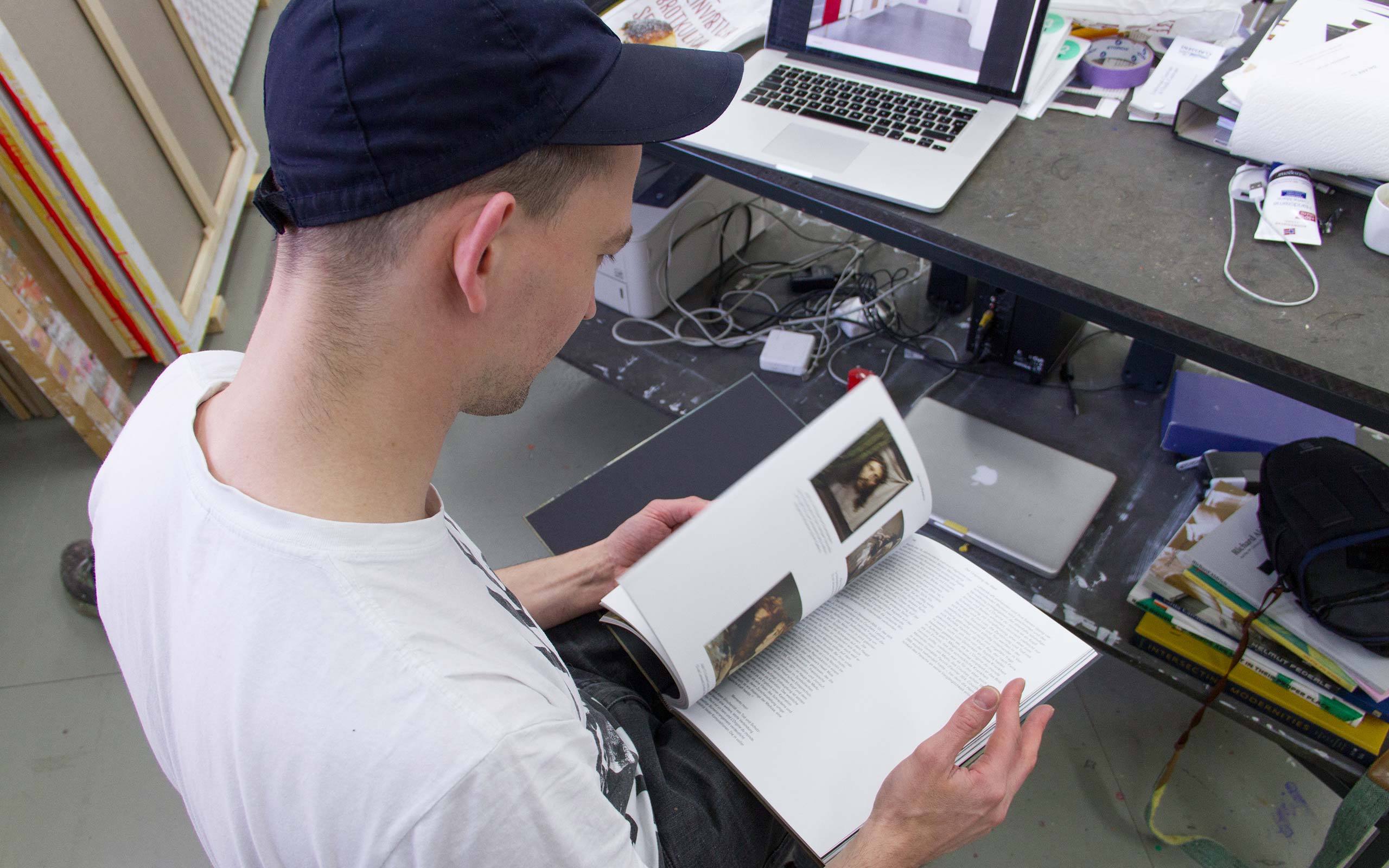

Wie kamst du zum Beispiel auf „Distinct Features of Fast Oscillations in Phasic and Tonic Rapid Eye Movement“, den Titel deiner Ausstellung in der Galerie Emanuel Layr in Wien 2016?
Zu dem Zeitpunkt habe ich einen Text von Jean-Luc Nancy gelesen, in dem es um die Umschreibung von Licht, dessen wahrnehmbare Brüche und die Frage nach dem sogenannten Distinkten in der Malerei ging. Mich interessieren solche bildtheoretischen Fragen: Was entnimmt das Bild der Realität? Wie entsteht durch Kodierung eine neue Realität? Und in welchem Verhältnis steht der Betrachter dazu?
Ein Abschnitt im Buch trägt den Titel Distinktes Oszillieren. Mir hat nicht nur diese Wortkombination gefallen, ich finde das Verhältnis von Text und Bild in Bezug auf die Malerei interessant. Im Netz bin ich beim Recherchieren durch Zufall auf den mit Distinct Features of Fast Oscillations in Phasic and Tonic Rapid Eye Movement betitelten Artikel in einer Fachzeitschrift für Neurologie gestoßen, der das Oszillationsprofil der phasischen schnellen Augenbewegung (Rapid Eye Movement), eine Form des REM-Schlafes, beschreibt. Bezogen auf die Konzeption der Ausstellung, empfand ich den Satz als Titel sehr passend. Außerdem denke ich, dass der Einsatz von Sprache auch eine Möglichkeit ist, der (visuellen) künstlerischen Praxis weitere Bedeutungsebenen zuzuführen.
Es geht dir also nicht darum, bei deinen Bildern einfach nur farbige Flächen zu malen, auch wenn es auf den ersten Blick für den Betrachter so aussehen mag.
Ja, das wäre mir definitiv zu langweilig. Es ist mir wichtig, diese semantische Recherche zu betreiben, bei der du auf verschiedene Dinge stößt, die der Interpretation dienen. Aus diesem Amalgam formt sich so etwas wie eine Geschichte, ein konzeptioneller Überbau. Gleichzeitig ist meine künstlerische Praxis extrem heterogen. Es geht mir mehr um eine Art von Setzung: die Beziehung von Bildern zueinander, das Konstruieren von Ausstellungen als Situationen …
Würdest du dich eigentlich als richtigen Maler bezeichnen?
Da bin ich mir selbst nicht sicher. (lacht) Nur weil ich Farbe auf einen Bildträger appliziere, heißt es ja noch lange nicht, dass man die Arbeit ausschließlich über den Diskurs der Malerei herleiten muss. Ich bin nicht der Typ von Maler, dem es vor allem um Formen und Komposition und den Prozess des Auftragens von Farbe bzw. Material geht.
Wichtiger als der Malprozess selbst ist für mich das Schaffen eines Kontexts, in den das Bild erst einmal eingebunden werden muss, damit es seine Berechtigung erhält. Ich verbringe tatsächlich fast mehr Zeit damit, im Studio mit Vektorprogrammen am Rechner zu arbeiten oder mit dem Herumschnipseln an Schablonen und Vorlagen, als mit dem eigentlichen Malprozess.


Trotzdem malst du deine Bilder immer noch von Hand, was man eigentlich erst bei näherer Betrachtung erkennt – sie könnten genauso gut aus dem Drucker stammen.
Für mich ist es nicht interessant, Bilder rein maschinell herzustellen. Das Spannende am manuellen Prozess ist doch noch immer die Möglichkeit des unerwarteten Zufalls.
Wie würdest du dich selbst einordnen?
Das kann ich wirklich nicht so einfach beantworten. Seit einiger Zeit stehe ich mit der französischen Kunsttheoretikerin und Kuratorin Marie de Brugerolle in kontinuierlichem Austausch über meine Arbeit. Sie beschäftigt sich in ihren Recherchen und wissenschaftlichen Arbeiten unter anderem mit dem französischen Künstler Guy de Cointet, der die Schriftsprache und ihre performative Übersetzung in den Raum thematisiert. Marie hatte, hiervon ausgehend, den interessanten Gedanken, meine Praxis in einen neuen Zusammenhang zu stellen: Die Malerei ist in dieser Situation nicht mehr nur Objekt an der Wand, sondern tritt zugleich in den Raum und wird auf erweiterten Ebenen lesbar. Das ist es auch, was ich vorhin meinte: Bilder im jeweiligen Ausstellungskontext bekommen eine völlig neue Bedeutung, und das nicht zuletzt im Wechselspiel mit dem Betrachter.
Einfach nur eine „schöne Ausstellung“ zu machen, wäre dir also eindeutig zu wenig?
Ja, das wäre vergleichbar mit der Idee von Salonmalerei zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Ich bin der Meinung, ein Bild sollte mehr können und fordern. Es sollte im Ausstellungsraum mit dem Besucher in Interaktion treten, ich will dem Betrachter aber kein Regelwerk zur Interpretation vorgeben: Über den Diskurs wird die Kunstgeschichte dann sozusagen fortgeschrieben. Man sollte in Ausstellungen mehr versuchen, radikalere Beziehungsgeflechte zu bauen und vorzuschlagen. Das geschieht meiner Meinung nach viel zu selten. Ich denke, dass hier viel öfter die diskursiven Grenzen ausgelotet oder überschritten werden könnten.
Abgesehen vom konzeptionellen Überbau, über den wir eben gesprochen haben, welche Rolle spielt eigentlich Ästhetik in Bezug auf deine Bilder?
Die Frage zur Ästhetik ist verknüpft mit der Bildrezeption. Mir geht es mehr darum, über die Malerei etwas zu testen, inhärente Konventionen zu befragen, sonst läuft man Gefahr, nur Formenvokabular zu deklinieren.
Wir hatten vorhin schon von „Oszillation“ gesprochen. Viele deiner Bilder oszillieren ja tatsächlich – durch die Verwendung von Neonfarben etwa, die hier gerade bei dir im Atelier stehen.
Das Oszillieren ist kein grundlegendes Merkmal meiner Bilder, trifft aber auf einige von ihnen zu. Ich arbeite häufig mit Komplementärfarben. Die Betrachtung dieser Bilder kann für das Auge leicht unangenehm sein, was beabsichtigt ist, denn es geht mir schon um ein Wechselspiel von Anziehung und Abstoßung.
Ich verwende eigentlich selten reine Farben direkt aus der Tube. Die Farben werden untereinander vermengt und als unreine Mischfarben sehr stark verdünnt in mehreren Schichten auf den jeweiligen Bildträger (Aluminium, HDF oder Leinwand) aufgetragen. In den Trockenphasen werden manchmal noch Abtönungen vorgenommen. Unterm Strich ist es ein wenig verrückt, gerade weil man die Farbe nie wieder zu hundert Prozent ident nachmischen kann.


Du bist österreichischer Künstler, lebst und arbeitest in Wien. Viele deiner Arbeiten befinden sich in privaten Sammlungen in Frankreich oder der französischsprachigen Schweiz und eher weniger in Deutschland. Wie erklärst du dir das?
So genau kann ich das gar nicht analysieren. Zum einen hat es wohl schon damit zu tun, dass ich längere Zeit im französischsprachigen Raum und den Beneluxstaaten gelebt habe, wo sich mein Interesse an bestimmten dort vorherrschenden Diskursen zur Malerei verfestigt und in meine eigene Arbeit übertragen hat.
Ohne zu verallgemeinern, glaube ich doch, dass die Auseinandersetzung in Deutschland anders geführt wird, also von anderen (kunsthistorischen) Fragestellungen ausgeht.
In der französischsprachigen Schweiz rund um Genf gibt es z.B. eine enge Verbindung zu Neo-Geo oder Hard-Edge Painting, eingebettet in einen Kontext, der sich im erweiterten Sinne speziell auch mit Strategien zum Display im Ausstellungsraum beschäftigt, rund um Leute wie John Armleder oder Francis Baudevin, die für mich dann schon auch relevant sind.
Warum bleibst du eigentlich in Wien?
Wien bietet schon eine sehr hohe Lebensqualität, gepaart mit sehr guten Produktionsbedingungen. Die Stadt hat eine angenehme Größe und Internationalität, man ist fast schon ein wenig verwöhnt, weshalb das Verlassen des Gewohnten hin und wieder gut und notwendig ist. Ich schließe es keineswegs aus, auch wieder einmal in einer anderen Stadt zu leben und zu arbeiten.
Du hast dich nach zwei unglaublich erfolgreichen, aber vermutlich auch sehr fordernden Jahren, 2015 und 2016, für einige Monate zurückgezogen, und es geht gerade erst wieder so richtig los.
Ich halte das für sehr wichtig, gerade in diesem Gegenwartsrausch dem Drang zu widerstehen und die eigene Geschwindigkeit zu drosseln, um seine Wahrnehmung wieder zu schärfen und neue Standpunkte entwickeln zu können – auch im Hinblick darauf, wie man seine eigene Rolle im Kunstbetrieb definiert. Für mich liegt die Erfüllung nicht im Mehr, Größer oder in noch mehr Akkumulation. Ich versuche, mir eine gewisse Gelassenheit zu bewahren. Für 2017 sind neue Ausstellungen bei Martin van Zomeren in Amsterdam und im neuen Galerieraum von Emanuel Layr in Rom geplant.







Interview: Florian Langhammer
Fotos: Florian Langhammer






